Themenfilter
Aktuellste Artikel
-
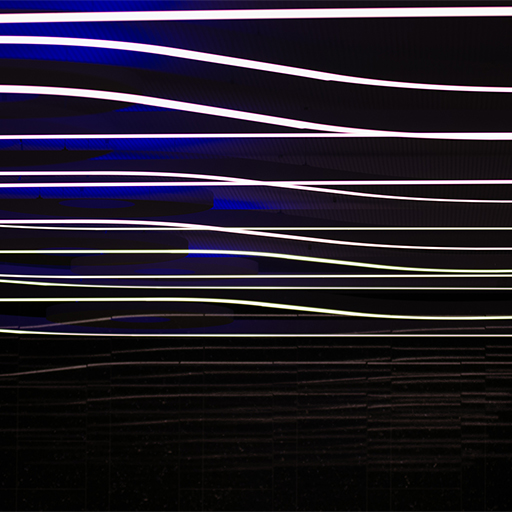
Jahressteuergesetz 2024: Erster Entwurf liegt vor
Kurz nach Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes liegt der (inoffizielle) Referentenentwurf für das JStG 2024 vor. -

Verpflichtende „No-Russia-Klausel“ für Verträge mit Geschäftspartnern in Drittländern
Die Anforderungen an die Exportkontroll-Compliance bei der Vertragsgestaltung mit Geschäftspartnern in Drittländern sind gestiegen. -
Hintergrundwissen, aktuelle Veranstaltungen und Praxistipps
In unserem Newsletter informieren wir Sie alle vier Wochen über die wichtigsten Updates für Unternehmerinnen und Unternehmer. -
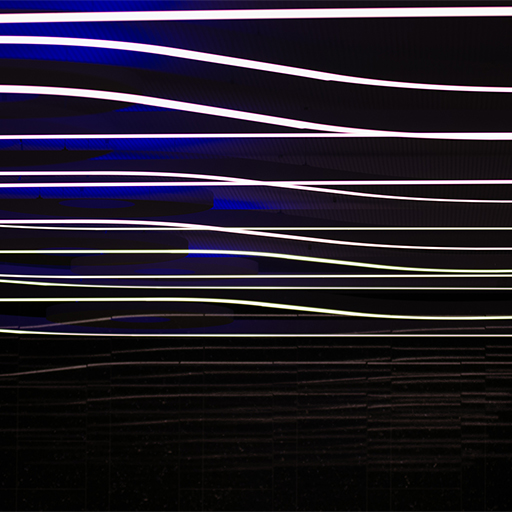
Wachstumschancengesetz: Änderungen für gemeinnützige Organisationen
Das Gesetz ist auf wirtschaftlich tätige Unternehmen ausgerichtet, daher berühren nur einige der enthaltenen Änderungen gemeinnützige Organisationen. Diese stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor. -
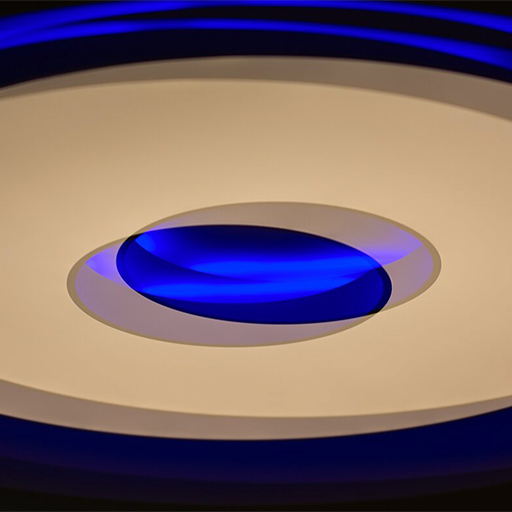
Wie moderne Sprach-KI das Wissensmanagement im Unternehmen optimieren kann
Mit Hilfe von moderner Sprach-KI wird Wissen in Unternehmen interaktiv und personalisierbar. -
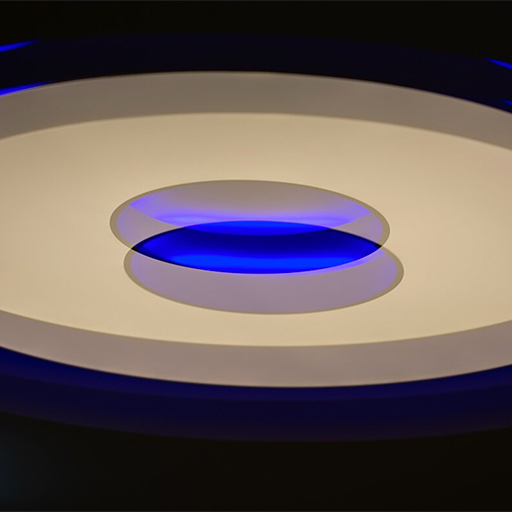
Google Consent Mode V2 und Datenschutz
Wir informieren Sie, wie Sie die Implementierung des Google Consent Mode V2 datenschutzkonform gestalten. -

Dienstwagen: Wirksame Beendigung der privaten Nutzungsmöglichkeit?
Eine aktuelle Entscheidung behandelt Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Beendigung der privaten Nutzungsmöglichkeit eines Dienstwagens. -
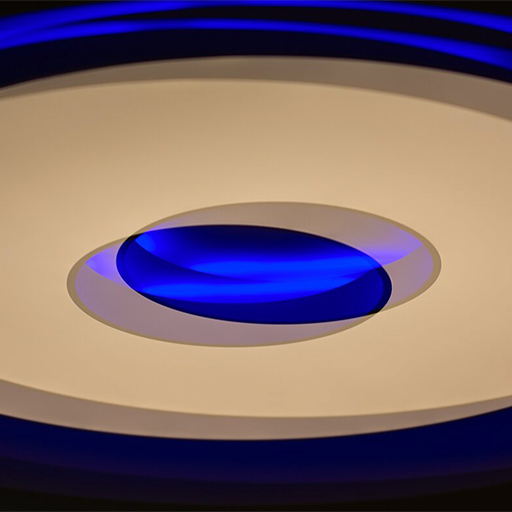
Der Weg zur DSGVO-konformen Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen
Unternehmen stehen vor der Herausforderung, KI effizient und zugleich datenschutzkonform einzusetzen. -

Arbeitgeberbewertungen im Internet
Eine aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg gibt Arbeitgebern jedoch mehr Rechte in Bezug auf anonyme Bewertungen.
Themen
- Arbeit
- Bewertungen
- D&O und W&I Insurance
- Digitale Transformation, Datenschutz und IT-Consulting
- Familienunternehmen und Unternehmerfamilien
- Finanzierung und Kapitalmarkt
- Gesellschaftsrecht
- Handelsrecht
- Immobilien
- Intellectual Property, Werbung und Medien
- Kritische Infrastruktur & kommunale Wirtschaft
- Life Science
- M&A und Umstrukturierung
- Nachhaltigkeitsberatung
- Prüfung und Rechnungslegung
- Sanierung, Restrukturierung und Insolvenz
- Steuern
- Vermögen und Nachfolge
- Web3, Blockchain & AI


